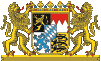kontrovers diskutiert
Ernährungswissenschaft im Fokus
Ernährungswissenschaft in Deutschland – wo stehen wir heute? Wo sollten wir hin? Diese Fragen diskutieren Prof. Dr. rer. nat. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Rechkemmer, Präsident und Professor am Max Rubner-Institut in Karlsruhe, und Prof. Dr. oec. troph. habil Hannelore Daniel, Lehrstuhl für Ernährungsphysiologie an der Technischen Universität München.
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Prof. Dr. Gerhard Rechkemmer; Foto: Max Rubner-Institut
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Prof. Dr. Hannelore Daniel; Foto: Technische Universität München
Wie ist die Ernährungswissenschaft entstanden? Warum gibt es sie? Warum ist sie wichtig?
Die Oecotrophologie hat sich zwischenzeitlich, wie alle Wissenschaftsbereiche, emanzipiert und diversifiziert. So gibt es eine verselbständigte Haushaltswissenschaft und eine Ernährungswissenschaft, die sehr viel akademischer sind als früher. Die Ernährungswissenschaft reicht dabei von der Genetik und Zellbiologie zur Epidemiologie und Biomedizin. Dennoch versteht sich die Ernährungswissenschaft in erster Linie immer noch als eine Versorgungswissenschaft – und zwar zur Verbesserung der Volksgesundheit. Das heißt, sie definiert ihre Bedeutung im Wissenschaftsbetrieb vor allem über die Ernährungsprobleme der Bevölkerung. Umgekehrt wird eben auch von der Ernährungswissenschaft erwartet, beständig Antworten auf alle angewandten Fragen des Essens und der Ernährung zu liefern. Wie kaum eine andere Wissenschaft konnte sie sich nie darüber definieren, dass sie grundlegende und ebenso spannende Fragen bearbeitet – losgelöst davon, ob sie jetzt vordergründig der Gesellschaft und der Gesundheit dienlich sind oder nicht. Eine Wende hat sie allerdings geschafft, denn noch in den 1960er-Jahren hieß es, wir sind wichtig, weil wir Sorge tragen, dass die Bevölkerung genügend Nährstoffe bekommt. Die Wende war, dass sie heute sagen kann, wir sind wichtig, weil die Energiezufuhr der Bevölkerung zu hoch und der Energieverbrauch zu gering ist. Die Frage ist, wie sieht Ernährungswissenschaft 3.0 oder 4.0 aus?
Mein Plädoyer lautet: Wir sollten uns nicht wichtig nehmen, weil die Gesellschaft Probleme hat, sondern wir sollten uns wichtig nehmen, weil die Fragen, die wir wissenschaftlich bearbeiten, wichtig sind. Die Fragen können bedeutungslos für die Gesellschaft sein, aber extrem relevant aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Ich würde mir wünschen, dass die Ernährungswissenschaft auch in andere Wissenschaftsbereiche eindringt – und das tut sie glücklicherweise.
Das Fach Ernährungswissenschaften entstand in den 60er- und 70er-Jahren im Umfeld der Agrarforschung und war damals wie auch heute an vielen Ausbildungsstätten in den agrarwissenschaftlichen Fakultäten eingegliedert. Während es zunächst um die Forschung rund um die Ernährung, z. B. die Deckung des Bedarfs an essentiellen Nährstoffen ging, spaltete sich das Fach später auf. In einigen Universitäten wurden die Haushaltswissenschaften einbezogen und der „Oecotrophologe“ in Abgrenzung zum Ernährungswissenschaftler wurde als Berufsbezeichnung eingeführt. Während sich die eigentlichen Ernährungswissenschaften weitgehend auf naturwissenschaftliche Inhalte konzentrierten, integrierten die Oecotrophologen auch in zunehmendem Maße soziologische Aspekte wie Ernährungsverhalten oder Themen wie Haushaltsökonomie.
Mit der Bologna-Reform hat sich inzwischen im Zuge der Einführung von Bachelor- und Master-Studiengängen eine Vielzahl unterschiedlicher Schwerpunktsetzungen ergeben, die dem Studiengang eine ganz neue Breite geben. Auch die Orte, an denen man Ernährungswissenschaften oder Oecotrophologie studieren kann, haben zugenommen: neben Gießen, sind es heute Stuttgart-Hohenheim, München, Bonn, Kiel, Potsdam, Jena, Halle und zahlreiche Hochschulen mit eigenen Profilen.
Ernährungswissenschaft in Deutschland – wo stehen wir heute? Wo sollten wir hin?
Ist eine bessere Vernetzung des Sektors Lebensmittel/Ernährung/Gesundheit notwendig? Ist die BMBF-Ausschreibung "Kompetenzcluster der Ernährungsforschung" eine Chance?
Die Absicht der Ausschreibung der Kompetenzcluster der Ernährungsforschung war es, nicht nur die fragmentierte Forschungslandschaft regional zu bündeln, sondern dort auch tatsächlich über Disziplingrenzen zu gehen. Geld hilft bekanntlich, aber Geld ist nicht alles. Das eigentliche Nadelöhr ist die begrenzte Zeit der Beteiligten. Es müssen auch die richtigen Menschen beteiligt sein, die bereit sind, sich auf diesen mühsamen Prozess einzulassen.
Sollte ernährungswissenschaftliche Forschung mehr gefördert werden? Woher sollte das Geld kommen?
Die in den letzten Jahren stark zunehmenden Forderungen der Forschungspolitik, sowohl im nationalen als auch im europäischen Rahmen, auf einen starken Anwendungsbezug und auf Innovationen sowie eine möglichst umgehende Umsetzung in wirtschaftlich verwertbare Produkte, macht die diesbezügliche Vergabe von Forschungsmitteln unter zwingender Beteiligung von Wirtschaftsunternehmen gerade in der ernährungswissenschaftlichen Forschung problematisch und unterliegt einer zunehmenden gesellschaftlichen Kritik. Aufgrund eines erheblichen Kenntnisdefizits sollte ein wesentlicher Teil der ernährungswissenschaftlichen Forschung als grundlagenorientierte Forschung und damit frei von einem direkten Anwendungsbezug finanziert werden. Die diesbezüglichen Möglichkeiten bei der DFG werden aber nur unzureichend wahrgenommen. Dies mag mit der bisher nach wie vor kleinen Zahl entsprechend qualifizierter Forscher und dem ständigen Rechtfertigungsdruck für die Existenzberechtigung dieser Disziplin im Bereich der Grundlagenforschung zusammenhängen.
Sollte sich in der Kommunikation der Forschungsergebnisse etwas ändern? Wie sollte eine sachgerechte Ernährungskommunikation aussehen?
Wenn Wissenschaftler in Fachmedien selbst berichten oder Pressestellen Forschungsergebnisse weitergeben, ist die Verantwortung jedes Einzelnen gefragt. Selbstverständlich ist darauf zu achten, dass Ergebnisse nicht aufgebauscht werden, um mehr Aufmerksamkeit dafür zu erlangen und dass Methoden und deren Grenzen klar kommuniziert werden.
Dies gilt in gleichem Maße für Journalisten. Ein Problem, dem wir am Max Rubner-Institut immer wieder begegnen sind Journalisten, die nicht das fachliche Wissen haben, um die Themen, über die sie berichten, selbst – zumindest bis zu einem gewissen Grad – zu durchdringen. Ein Problem, das bei angewandten Wissenschaften nicht selten ist. Wie aber soll ein solcher Journalist erkennen können, ob er mit seinem Ansprechpartner einen seriösen Wissenschaftler vor sich hat – oder womöglich einen der selbsternannten Experten, die es gerade beim Thema Ernährung sehr häufig gibt? Insbesondere, wenn die Zeit drängt und mehr als ein Gespräch zum Thema nicht vorgesehen ist? In diesem Sinne würden wir uns mitunter wünschen, die Journalisten würden das Thema Ernährung ernster nehmen und es würde von Redaktionen nicht als ein Thema für Volontäre oder Praktikanten gesehen, da diese ja auch „jeden Tag Essen und Trinken und deshalb für Ernährungsthemen kompetent“ seien. Es geht nicht darum, dass Journalisten Ernährungswissenschaftler sein müssen, um gut über das Thema zu schreiben, aber einige wissenschaftliche Grundlagen sollten doch vorhanden sein. Wenn dann die journalistischen Sorgfaltspflichten noch beherzigt werden, wäre der Ernährungskommunikation insgesamt gesellschaftlich sicherlich besser gedient.
Sollte ein Ethik-Kodex entwickelt werden? Sollte er für alle Journalisten und Wissenschaftler bindend sein? Welche Punkte sollte er Ihrer Meinung nach beinhalten?
Aus anderen Rubriken
Workshop-Rückblick
Mythen und Fakten in der Ernährung
Wie lassen sich Studienergebnisse interpretieren? Ist Milch schädlich und vegane Ernährung gesund? Und was können Journalisten tun, um Lesern, Zuschauern sowie Zuhörern mehr Klarheit über das Wissensgebiet Ernährung zu verschaffen? Mehr